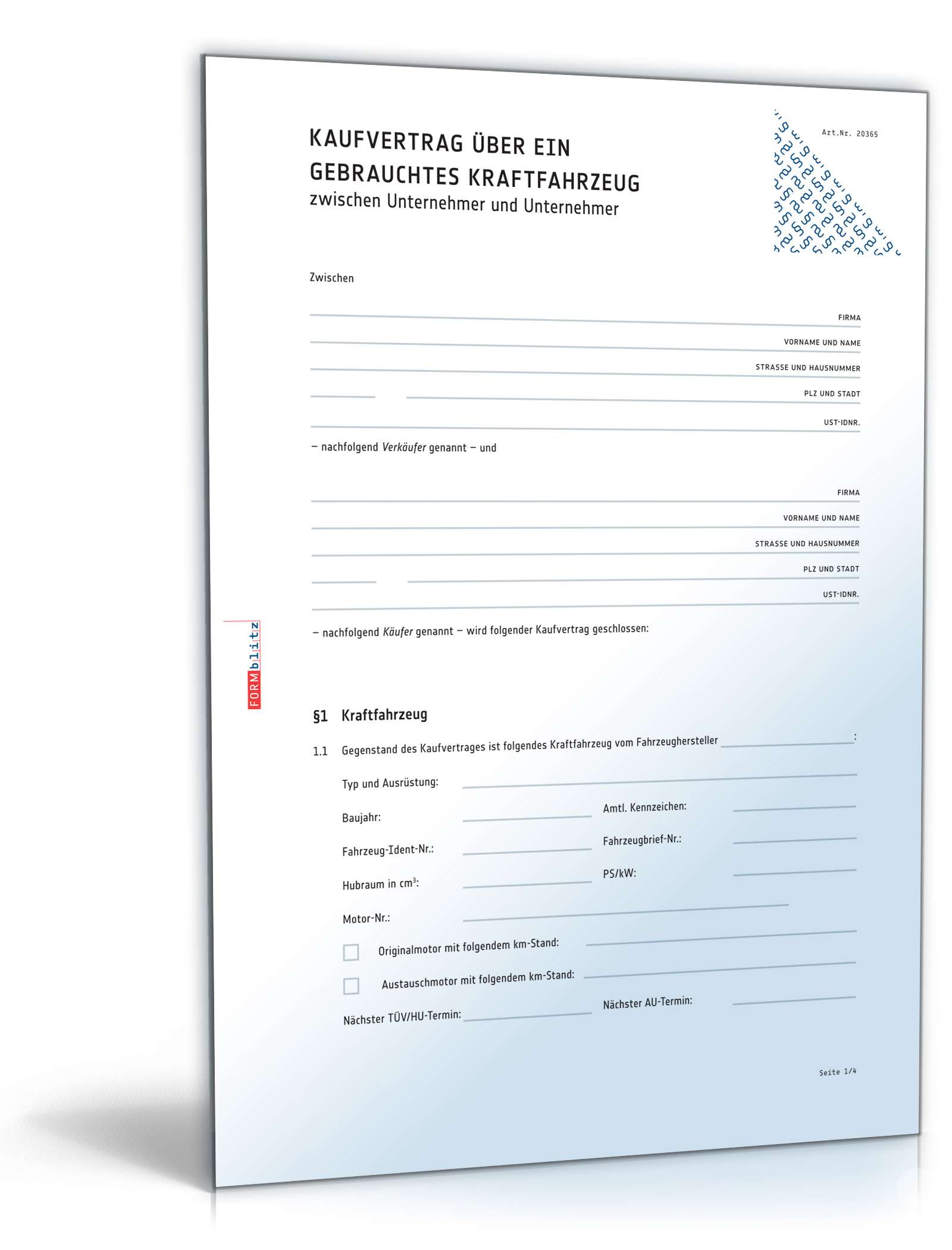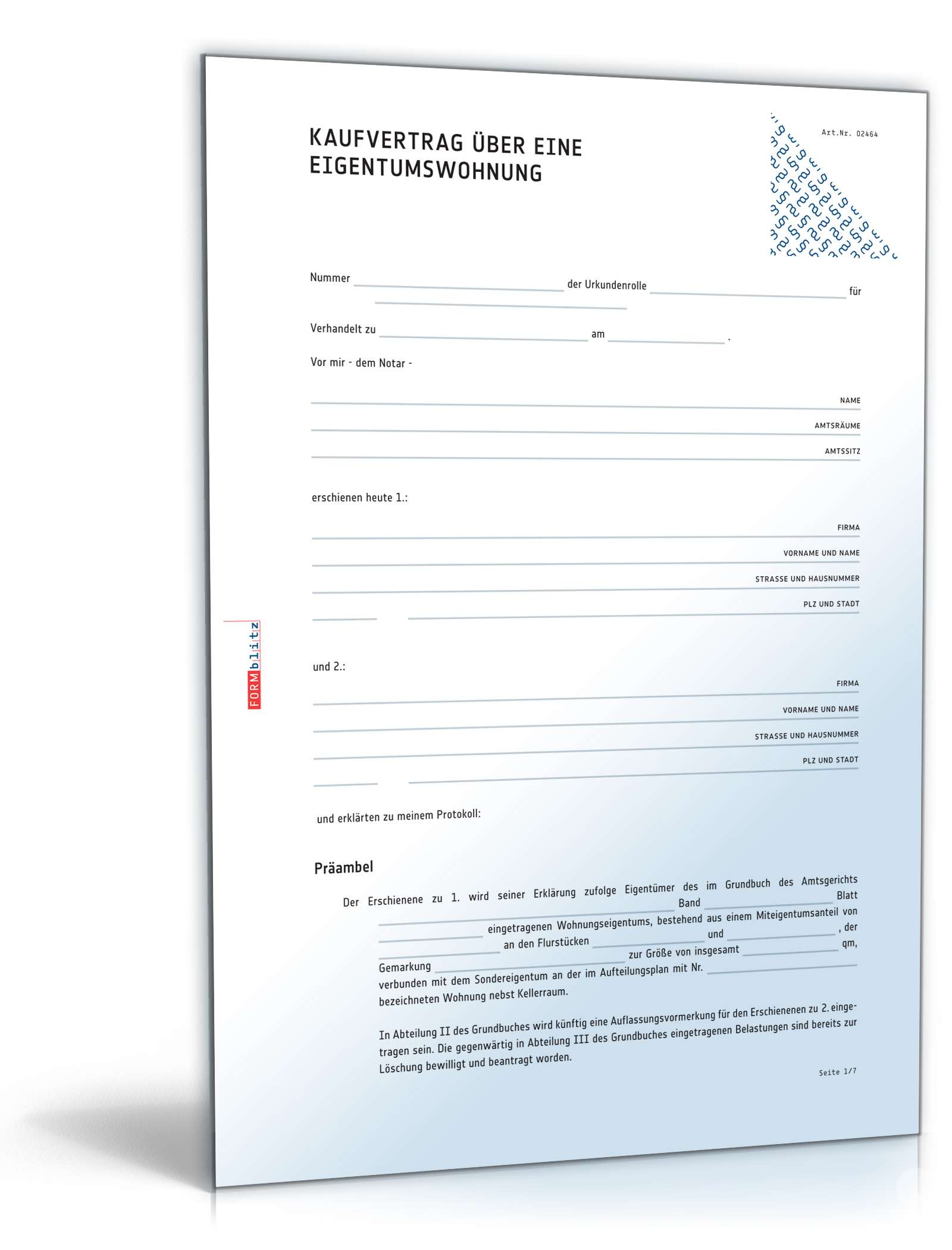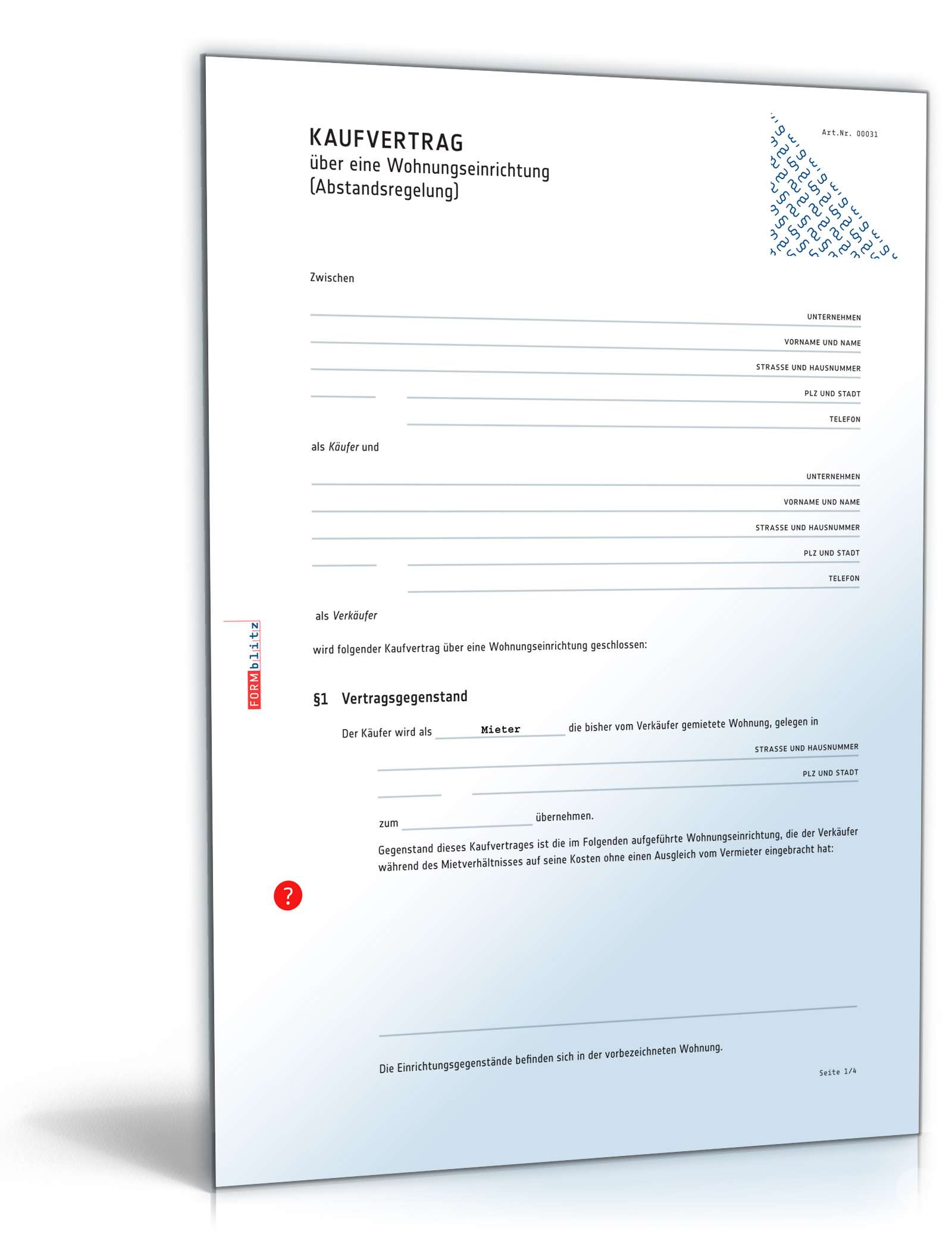Am 1. Januar 2022 sind zahlreiche Regelungen in Kraft getreten, mit denen das Kaufrecht zum Schutz der Verbraucher reformiert werden sollte. Vielen Verbrauchern und auch Händlern sind die Gesetzesänderungen aber noch immer unbekannt. Lesen Sie hier, was Sie als Händler und Shop-Betreiber über neue Gewährleistungsrechte des Käufers und welche Folgen neues Kaufrecht bei Abschluss eines Kaufvertrages wissen müssen.
Neues Kaufrecht definiert Mangel neu
Bei der Beantwortung der Frage, ob ein Mangel der Kaufsache vorliegt, hat man bisher unterschieden zwischen den subjektiven Anforderungen, also der vereinbarten Beschaffenheit einer Kaufsache, und den objektiven Anforderungen, ob man das Kaufobjekt bestimmungsgemäß verwenden kann. Bisher reichte die vereinbarte Beschaffenheit aus, damit sich der Verkäufer auf Mangelfreiheit berufen konnte. Damit ist nun Schluss. In § 434 BGB ist der Sachmangel neu definiert. Das hat Einfluss auf die Mängelhaftung. Bei einer Vereinbarung über die Beschaffenheit der Kaufware muss diese auch immer zusätzlich für die gewöhnliche Verwendung geeignet sei. Die Beschaffenheit muss generell so sein, wie bei Sachen derselben Art üblich. Das gilt sowohl für Neuware also auch für gebrauchte Ware. Zusätzlich ist die Ware mit dem vereinbarten Zubehör und den üblichen Anleitungen, einschließlich Montage- und Installationsanleitungen, zu übergeben.
Hinweispflicht bei Verkauf von B-Ware und Gebrauchtware
Verkäufer von Ausstellungsstücken konnten bisher einfach in die Artikelbeschreibung herein schreiben, dass die Ware leichte Gebrauchspuren hat. Nun müssen Händler darüber hinaus bei Vertragsschluss dokumentieren, dass der Käufer über die Mängel informiert war. Bei einem Kauf mit Kaufvertrag, kann dies direkt im Vertragstext vereinbart werden. Zählen Sie hier am besten die Mängel auf. Mit der Unterschrift bestätigt der Käufer seine Kenntnis. Aber Vorsicht: Ein in den AGB versteckter Hinweis genügt den neuen Anforderungen nicht. Und wer seine Ware online anbietet, muss prüfen, ob der Kaufprozess noch den aktuellen Anforderungen entspricht. So kann der Verkäufer zu Beweiszwecken beispielsweise eine eigene Checkbox einbauen, mit der der Käufer bestätigt, dass er bewusst einen mangelhaften Gegenstand gekauft hat.
Achtung: Ohne eine solche Dokumentation, kann der Käufer später auf sein Gewährleistungsrecht pochen, selbst wenn der Shop in der Artikelbeschreibung auf Ausstellungsstück, B-Ware etc. hingewiesen hat.
Mangelbeseitigung: Verjährungsfrist kann gehemmt sein
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beim Warenkauf beträgt weiterhin 24 Monate ab Erhalt der Sache. Allerdings wird diese Frist nun in zwei Fällen gehemmt:
- Nachbesserung durch den Verkäufer: Falls innerhalb der Gewährleistungsfrist ein Mangel auftritt und der Verkäufer diesen durch Neulieferung oder Reparatur beseitigt, tritt die Verjährung grundsätzlich erst nach Ablauf von zwei Monaten nach Rückgabe der nachgebesserten Sache an den Verbraucher ein.
- Auftritt des Mangels vor Ablauf der Gewährleistung: Wenn sich der Mangel erstmalig kurz vor Ablauf der Gewährleistung zeigt, verjährt der Anspruch auf Mangelbeseitigung erst vier Monate ab dem Zeitpunkt, in dem der Mangel erstmalig aufgetreten ist. Zeigt sich der Mangel also erst im 22. Monat nach Kauf, dann verlängert sich die Gewährleistungsdauer auf 26 Monate.
Neues Kaufrecht: Ausdrückliche Fristsetzung bei Gewährleistung entfällt
Bisher konnte der Käufer die Rückabwicklung des Kaufvertrages nur verlangen, wenn der Verkäufer nicht innerhalb einer gesetzten Frist nachbessert hat. Diese Formalie entfällt ab 2022. Sobald der Käufer den Verkäufer über den Mangel unterrichtet beginnt eine “angemessene Frist”. Eine ausdrückliche Fristsetzung muss der Käufer nicht erklären. Wenn der Verkäufer den Mangel nicht beheben kann, darf der Käufer das Geld zurück verlangen. Achten Sie dennoch darauf, dass Sie das Nachbesserungsverlangen schriftlich dokumentieren.
Beweislastumkehr dauert nun 12 Monate
Eine weitere verbraucherfreundliche Neuerung ist die Verlängerung der Beweislastumkehr. Bisher galt: Innerhalb der ersten sechs Monate nach Kaufdatum, bestand die gesetzliche Vermutung, dass ein aufgetretener Mangel bereits bei Übergabe der Kaufsache vorlag. Der Verkäufer musste mithin den Beweis dafür antreten, wenn er der Meinung war, der Käufer habe die Ware unsachgemäß bedient und damit selbst den Fehler ausgelöst. Nun besteht diese Beweislastumkehr im Zusammenhang mit der Mängelhaftung für Verkäufer sogar bis zu 12 Monate nach dem Kauf (siehe § 477 BGB).
Aber Achtung: Die verlängerte Frist betrifft nur Kaufverträge, die ab dem 1. Januar 2022 geschlossen werden.